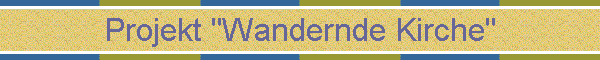
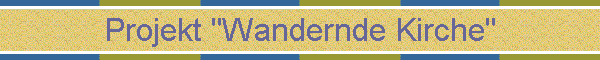
Die Dokumentation der Tätigkeiten des katholischen Seelsorgsdienstes für die „Wandernde Kirche“ unter der Leitung von Dipl.-Theol. Thomas Flammer und Prof. Dr. Hubert Wolf ist ein von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördertes Projekt.
Projektleitung: Dipl.-Theol. Thomas Flammer; Prof. Dr. Hubert Wolf
Mitarbeiterin: Barbara Weltermann, stud. theol.
Kurzbeschreibung des
Forschungsvorhabens:
Über Jahrhunderte konzentrierte sich die katholische Seelsorge auf die Gemeinde vor Ort. Es gab ein fest umrissenes Seelsorgsgebiet und eine mehr oder minder konstante Zahl von Gläubigen, die ihrer Umgebung entsprechend im christlichen Glauben verwurzelt waren. Selbst die im Zuge des Übergangs von der traditionellen zur modernen Gesellschaft einsetzende Mobilität, die etliche Menschen vom Land in ihnen fremde Gebiete oder in Städte ziehen lies, wirkte sich nicht allzu einschneidend auf die eingespielten und scheinbar bewährten Seelsorgsmodelle aus. Sie funktionierten nach wie vor, und es gelang zügig, die Binnenwanderer in ihrem neuen gesellschaftlichen Kontext auch kirchlich zu integrieren.
Wie jedoch reagiert die kirchliche Seelsorge, wenn aufgrund der Anordnungen eines nationalsozialistisch geführten Staates quasi über Nacht hunderttausende ihrer Gläubigen aus den bisherigen Lebensumfeldern herausgerissen werden und die ursprüngliche Heimat durch Reichsarbeits- und andere Pflichtdienste, die gezielte Arbeitsmarktlenkung und Industriealisierung (u.a. zum Aufbau der Volkswagen- und Hermann-Göring-Werke), Umsiedlung und Krieg zeitweise oder gar für immer verlassen? Mit welchen Mitteln versucht man diese Betroffenen, die sogenannte „Wandernde Kirche“, im kirchlichen Einflussbereich zu halten? Und wie stark ist die religiöse Verankerung der Wandernden, wenn sie mit ganz anderen katholischen Lebensweisen, dem Leben in der Diaspora und dem Leben in nationalsozialistisch ausgerichteten Arbeitslagern konfrontiert werden?
Wie kirchliche Seelsorge auf diese neuen Anforderungen einer mobilen Gesellschaft antwortete, soll die geplante erstmalig-detaillierte Darstellung über Arbeit und Aufgaben des 1934 vom deutschen Episkopat gegründeten Katholischen Seelsorgsdienstes für die Wandernde Kirche aufzeigen. Anhand einer kommentierten Edition der jährlich vom Seelsorgsdienst herausgegebenen Tätigkeitsberichte sowie weiterer ausgewählter Schlüsselquellen wird das anvisierte Projekt zur differenzierteren Verortung der Kirche und überhaupt des Katholizismus im Dritten Reich beitragen sowie außergewöhnliche und aufschlussreiche Einblicke in eine der wohl schwierigsten Aufgaben der Katholischen Kirche zwischen 1933-1945 eröffnen. Es wird sich einerseits zeigen, wie schwer es für den Seelsorgsdienst war, den kirchlichen Kontakt zu den bis 1942 insgesamt 6,5 Millionen binnenwandernden Katholiken (~ 27 % aller Katholiken) zu bewahren und sie weiterhin im Einflussbereich der Kirche zu halten; und andererseits, wie erstaunlich fest die Verankerung in Glauben und Milieu sein konnte und wie Katholiken unter den schwierigsten Umständen für diesen Glauben eintraten. Darüber hinaus ermöglicht das Projekt nicht nur bedeutende Erkenntnisse über die kirchliche Situation der katholischen Diaspora und die Integration der Zugezogenen, die erstmalig tragende Rolle von weiblichen Laienhelferinnen, sondern bietet auch wichtige Hinweise zur derzeit aktuellen Frage des Verhältnisses der Katholischen Kirche bezüglich ausländischer Katholiken, da zu den Aufgaben des Seelsorgsdienstes auch die Betreuung ausländischer Arbeitskräfte, Kriegsgefangener sowie der Kontakt zu ausländischen Geistlichen zählte.
Hier ausführliche Informationen zum
Projekt „Wandernde Kirche“